
Wie erinnert eine Stadt an das, was ihre Identität ausmacht? An das Gute und das Grauen?
Bendix hat sich darüber Gedanken gemacht und stellt uns Oldenburger Erinnerungsorte vor.

Wie erinnert eine Stadt an das, was ihre Identität ausmacht? An das Gute und das Grauen?
Bendix hat sich darüber Gedanken gemacht und stellt uns Oldenburger Erinnerungsorte vor.
Der Erinnerungsgang2020 und unsere Aktionen auf Oeins!
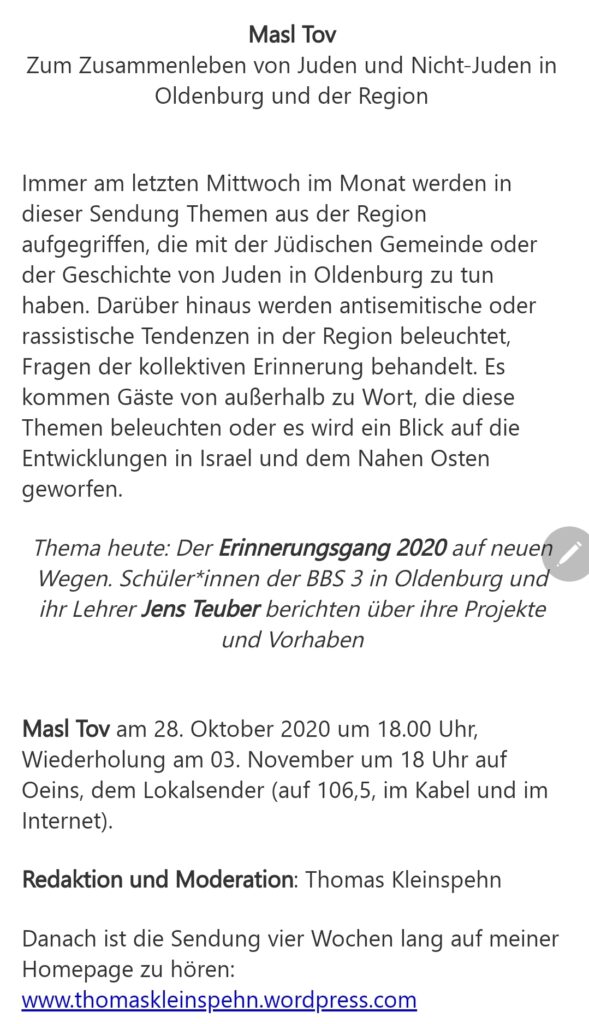
Hier könnt Ihr die Sendung hören. Es lohnt sich!
צעדת זיכרון 5781


Wir haben uns in Oldenburg umgesehen. Wo hat sich früher jüdisches Leben abgespielt? Und so sieht es heute aus.
Zum Hintergrund des „Abraham“ gibt es diese hervorragende Seite:
http://www.alt-oldenburg.de/straen-a-k/abraham-winkelgang/index.html

Wie mag es wohl einem Kind gegangen sein, das nach den Prinzipien Johanna Haarers erzogen wird? Wir haben uns darüber Gedanken gemacht und diese fiktiven Tagebucheinträge verfasst:
„Heute war ich zum Spielen wieder draußen. Es war sehr schönes Wetter und ich rannte durch den Garten. Ich wollte mir andere Kinder zum Fangen spielen suchen, doch die Straßen waren trotz schönem Wetter leer. Meine Mutter stand an der Tür und beachtete mich kaum, sondern schaute nach ihren Blumen.
Als ich auf den hohen Baum kletterte, sah ich von oben runter zu meiner Mutter und wollte ihr winken, doch als ich mich nicht mehr so doll festgehalten habe, verlor ich mein Gleichgewicht und fiel herunter.
Ich schrie laut auf und weinte, weil mir alles wehtat. Meine Mutter kam langsam auf mich zu. Sie meinte: „Hör auf zu weinen und stell dich nicht so an. Du hast selbst Schuld.“ Das verletzte mich sehr, da ich lieber von ihr getröstet werden wollte.“
„Heute ist mein zehnter Geburtstag.
Ich habe mich schon sehr lange auf diesen Tag gefreut und hielt es vor Spannung gar nicht mehr aus. Ich ging am Morgen herunter und erhoffte mir einen Kuchen. Außerdem hatte ich mir eine Spielpuppe gewünscht, die ich hoffentlich gleich in meinen Händen halten durfte. Ich habe mir die blonde Puppe schon sehr lange gewünscht.
Doch als ich herunterkam sah ich nichts. Keinen Kuchen und keine blonde Puppe.
Meine Mutter kam auf mich zu und drückte mir ohne ein Wort eine Adolf Hitler Puppe in die Hand und ging wieder in ihr Büro, um an ihrem Buch zu schreiben.
Ich war sehr traurig, denn sie gratulierte mir nicht und eine Umarmung wäre wohl auch zu viel gewesen.
Ich würde so gerne etwas mehr Liebe von meiner Mutter bekommen.“

Die Mutter eines Kleinkinds versucht, ihr Kind nach den Prinzipien Johanna Haarers zu erziehen. Hier ihr (fiktiver) Tagebucheintrag:

„Meine Tochter ist nun etwas mehr als ein Jahr alt und sie fängt an, viel zu schreien und sich mir zu wiedersetzten. Gestern war wieder ein Moment, wo sie ihren Brei nicht essen wollte. Auch nach mehrmaliger Aufforderung wollte sie ihn nicht essen, sodass ich sie in die Abstellkammer brachte und sie dort eine Weile drinsitzen ließ. Sie schrie und weinte und es zerriss mir das Herz, doch ich musste so so handeln, damit sie ihr Verhalten änderte. Kurz nachdem sie aufhörte zu schreien, holte ich sie wieder heraus und sie aß den Brei. Mein Durchsetzungsvermögen hatte gewirkt. Sie muss lernen, dass ich mich nicht nach ihr richte.Meine Nachbarin, etwas älter als ich und Mutter von drei Kindern, fragte mich, warum ich dem Ratgeber folgte. Ihrer Meinung nach zog ich einen „gefühlslosen und kalten“ Menschen heran, doch ich lachte sie nur aus. Ich fragte sie, warum sie dem Buch nicht folgte, denn immerhin zog ich mein Kind so groß, wie es Johanna Haarer empfahl und ich vertraute ihr. Immerhin waren ihre Vorschläge so, wie es unser Führer wollte und verlangte.“
Johanna Haarer, Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind, veröffentlicht 1934
Eine Gruppe von Schülerinnen des Beruflichen Gymnasiums hat sich mit Johanna Haarers „Erziehungsratgeber“ „Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind“ beschäftig. Sie haben versucht, sich in eine Mutter hineinzuversetzen, die ihr Kind nach diesen Prinzipien zu erziehen versucht.
Annalena Kloß hat dazu einen fiktiven Tagebucheintrag verfasst:

„Kurz bevor ich meine kleine Tochter zur Welt brachte, hatte mir meine Mutter ein Buch von einer Ärztin namens Johanna Haarer gegeben: „Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind“. Meine Mutter meinte, „es sei perfekt für junge Mütter“ und so nahm ich es an und las es. Ich hielt mich an die Dinge, die im Buch geraten wurden, sodass ich veranlasste, direkt nach der Entbindung (fünf Tage, nachdem mir meine Mutter das Buch geschenkt hatte) mein Kind nur zum Stillen zu bekommen und es nachts schreien zu lassen. Viele schauten mich mit einem ungläubigen Blick an und mein Mann hielt mich für „kaltherzig“ aber so schrieb es mir der Ratgeber vor. Es hieß, dass „jeder Säugling von Anfang an nachts allein sein soll, damit es begreift, dass schreien nichts nützt. Dies würde es innerhalb weniger Nächte lernen. Es sei eine Kraftprobe zwischen Mutter und Kind.“ Es war sehr schwer, mich daran zu halten, denn ich wollte mein Kind nicht nur beim Stillen betrachten. Ich wollte es schlafend in meinen Armen halten und jede kleinste Bewegung beobachten. Ich wollte ihr tausende Küsschen geben, doch jegliche Liebe ist mir verboten. Ich hoffe, dass mich diese Qual zu einer guten Mutter macht, die man sich heutzutage wünscht.“

Wir haben uns Gedanken gemacht, wie ein Gespräch mit Leo Trepp, dem Rabbiner, der 1938 in Oldenburg tätig war, gewesen sein könnte. In unsrem Podcast „Discover history“

Rassismus und Antisemitismus funktionieren, wenn die Sprache entsprechend codiert ist. Wir haben uns damit beschäftigt und ein Erklärvideo dazu erstellt. Viel Spaß beim schauen, Liken und Teilen!
Das Erklärvideo zu Kübra Gümüsays „Sprache und Sein“:
https://www.hanser-literaturverlage.de/buch/sprache-und-sein/978-3-446-26595-0/
In unserer Spotify-Playlist
https://link.tospotify.com/5IWf1efZzab
könnt Ihr einen Song finden, mit dem wir uns beschäftigt haben
https://link.tospotify.com/NRtX9OkZzab
Geiler Song, erschütterndes Video.
Dazu dieser tweet:
Der link zum Blog bringt Hintergründe, der link zu Youtube das Video. Aber Triggerwarnung: Viel Gewalt.


Gunda Trepp im Interwiew über ihren Mann Leo Trepp, der 1938 Rabbiner in Oldenburg war.
Schülerinnen und Schüler aus dem Religionskurs des Beruflichen Gymnasiums der BBS 3 der Stadt Oldenburg befragen die Witwe des Oldenburger Rabbiners, der 1938 seine Synagoge hat brennen sehen müssen.
Zwei Frauen und ein emanzipierter Rabbiner
So beginnt Leo Trepp im Jahr 1988, dem Jahr des Erinnerungsganges in Oldenburg, zugleich eine neue Phase in Mainz und streckt den Menschen in den zwei Städten seine Hand aus. Und ein wenig wird er an beiden Orten wieder zu dem, der er einst dort war. Hier der Meenzer, der mit einem Glas Wein am Rhein sitzt und seine Zigarre schmaucht, und gleichzeitig einer der letzten Vertreter einer großen Tradition ist, einer Gemeinschaft, die eine so bedeutende Kultur schuf, dass Mainz im Mittelalter zusammen mit Speyer und Worms Architektur, Rechtsprechung und Religion der jüdischen Diaspora weit über die Grenzen des deutschen Reichs hinaus beeinflusste, so dass die drei als die sogenannten Schum-Städte weltweit bekannt bleiben.
Und in Oldenburg wird er wieder zum Gemeinderabbiner, ein bisschen jedenfalls, und mit vorsichtiger Hoffnung auf die Zukunft. Anfang der Achtziger hat sich eine kleine jüdische Gruppe gebildet, in der bald Sara-Ruth Schumann den Ton angibt, eine zierliche Mitarbeiterin des Kulturamtes, Tochter eines Überlebenden, die zu ihrer Religion zurückgefunden hat, und in den nächsten Jahrzehnten zusammen mit anderen eine Gemeinschaft aufbauen wird, die Leo Trepp bis zuletzt mit einer Art väterlichem Stolz als „Mustergemeinde in Deutschland“ bezeichnet. 1992 unterschreiben sechzehn Mitglieder das Gründungsprotokoll. Wissen ist spärlich. Sie lernen. Und lernen. Jahrelang unterrichtet sie der niedersächsische Landesrabbiner Henry Brandt, einmal im Monat gibt es diese Intensivkurse, die restliche Zeit studieren sie allein weiter. Die frischgebackenen
Gemeindemitglieder treffen sich in Schumanns kleiner Kunstgalerie und wagen die ersten Freitagabendgottesdienste, „learning by doing“, wie Schumann später sagt. Trepp will sich nicht aufdrängen, ist aber da und unterstützt die kleine Truppe vor allem in der schwierigen Gratwanderung, sich von den Orthodoxen zu distanzieren und einen Platz im jüdischen Leben in Deutschland zu finden, nie bevormundend, sondern pragmatisch, wie Gründungsmitglied und der damalige Präsident der Carl von Ossietzky Universität, Michael Daxner, später erzählt, „Warum macht ihr das nicht so und so’, hat er dann gefragt und uns ein bisschen geschubst. Es ist sicherlich auf seinen Einfluss zurückzuführen, dass wir in Oldenburg ein konservativ liberales Judentum haben.“
Anfang der neunziger Jahre steht die frühere Baptistenkiche nach langjähriger anderweitiger Nutzung wieder leer. Der Kulturdezernent sieht das Potential sofort. Dies könnte das Zuhause für die junge Gemeinde werden. Beide Rabbiner, Trepp und Brandt, nicken ab. Das Gebäude liegt unweit des Platzes, an dem die alte Synagoge und Schule standen. Die politischen Spitzen der Stadt einigen sich schnell darauf, das Projekt zu unterstützen, Ekkehard Seeber treibt die für Oldenburger Verhältnisse hohe Geldsumme für das Vorhaben auf, und als weiterhin ein hoher Betrag fehlt, schreibt Trepp einen Brief an ein einflussreiches Mitglied der Stiftung Niedersachsen. Die Oldenburger bekommen ihr Geld zusammen. Die Umbaukosten übernimmt die Stadt. Über das Eingangsportal platzieren die Maurer während der Sanierung den Schmuckstein der erweiterten Synagoge von 1855, der den Brand überstanden hat, nach dem Pogrom muss ihn jemand weggeschleppt haben. Zumindest findet ihn ein Gärtner nach dem Krieg auf dem Nachbargrundstück. Bet Elohim steht darauf. Das Haus Gottes. Nicht jeder will das haben. Der Nachbar jedenfalls nicht, der sich von möglichen Anschlägen auf die Juden bedroht fühlt. Die Stadt muss zwei Prozesse mit ihm führen.
Als Leo Trepp im März 1995 zur Einweihung der Synagoge nach Oldenburg kam, traf ich ihn zum ersten Mal. Bei einem Empfang am Tag davor umringten ihn dutzende Menschen, unter ihnen mein erster Mann, dem es gelang, sich mit dem Rabbiner für den nächsten Morgen zum Frühstück im gemeinsamen Hotel zu verabreden. Ich weiß nicht mehr, worüber wir sprachen, doch ich erinnere mich, wie krank Leo an diesem kalten nassen Frühlingstag aussah, mit rotem Schal um den Hals und leiser Stimme, und ich dachte, „der gehört ins Bett.“ Ich kannte ihn eben noch nicht. Zwei Stunden später hält er seine Festrede, kraftvoll und energisch, spricht über das Menschenbild der Juden, in dem Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen den Religionen zu respektieren seien. Und dann, unter gegenseitiger Anerkennung, sagt er, könnten Juden und Christen zum Segen aller zusammenarbeiten.
Auch in den Vereinigten Staaten fordert er Juden und Christen auf, gemeinsam zu kämpfen, um „Menschen von ihren Fesseln zu lösen, Verfolgte zu befreien und ihr Joch zu brechen, Brot mit den Hungernden zu teilen, Obdachlosen ein Dach zu geben, die Nackten zu kleiden und niemals wegzuschauen“, wie es der Talmud sagt. Gunda Trepp, Der letzte Rabbiner, 241 ff. © WBG
Nachdem den Juden am Anfang der Weimarer Republik eine Hasswelle von lange nicht mehr dagewesenem Ausmaß entgegengeschlagen war, beruhigte sich die Stimmung etwas. In den Jahren zwischen 1924 und 1929, die Trepp als die „guten Jahre“ bezeichnet, gab es Jacob Borut zufolge weniger Vorfälle, doch ab 1927 stieg die Zahl der antisemitischen Angriffe auf Bürger und Synagogen, Geschäfte und besonders Friedhöfe wieder an und sollte von da an nicht wieder abebbnen.
Wie Borut berichtet, schienen in der breiteren Öffentlichkeit vor allem die Pogrome im Berliner Scheunenviertel 1923 und am Kurfürstendamm zum jüdischen Neujahrsfest im November 1931 Aufmerksamkeit gefunden haben, obgleich Juden in allen Orten in Deutschland, besonders in Bayern und den östlichen Provinzen, angegriffen worden seien, und es dabei schwerwiegendere Vorfälle als die beiden Attacken in Berlin gegeben habe. Die Reaktion auf den Übergriff am Kurfürstendamm unterstreicht die Beobachtung von Leo Trepp, dass die Partei genau darauf achtete, was sie dem Volk zumuten könne: „Bei jedem
Schritt loteten die Nazis aus, wieweit sie gehen konnten. Erschwerung und
Erleichterung. Oder, wenn die Bürger es akzeptierten, nur Erschwerung.“ Während der Angriffe, gesteuert unter anderen von Joseph Goebbels und ausgeführt von kleineren SA Truppen, wurden einige Juden schwer verletzt. Selbst die national gesinnte Presse zeigte sich empört, und die Täter wurden in Schnellverfahren zu, im einzelnen hohen Haftstrafen verurteilt. Bei Angriffen auf Juden setzten die Rechten zwar brutalste Gewalt ein, benutzten aber, anders als bei Attacken gegen Kommunisten, keine Waffen. Offensichtlich gingen die Verantwortlichen davon aus, dass die Bevölkerung bestimmte Gewaltexzesse nicht mitzutragen bereit war.
Gewalt an sich schien weithin akzeptiert. In Mainz begnügt man sich zu dieser Zeit noch mit Äußerungen und nonverbaler Verachtung. Doch wie Leo Trepp erzählt, rotteten sich, als die jüdische Theatergruppe Habima zum Gastspiel in die Stadt kam, soviele Menschen im Protest zusammen, dass die Polizei das gesamte Theater besetzen musste.
Als die „guten Jahre“ zwischen 1924 und 1929 sich dem Ende näherten, enthüllte sich die Ideologie immer mehr. Der Nationalsozialismus machte sich auch im
Unterricht selbst bemerkbar. „Da sieht man mal, die Juden haben schon die Ägypter ausgebeutet“, sagte jemand im Geschichtsunterricht. Das war absurd, ich habe den Zusammenhang vergessen. Ich spürte intuitiv, welche Schüler und Lehrer Antisemiten waren und versuchte, mich von ihnen fernzuhalten, was irgendwann unmöglich wurde. Denn das Gift schlich von draußen in die Klassenräume hinein. Ging man in die Stadt, war man dem Einfluss der „Bewegung“ ausgesetzt. Las man die Zeitung, war die Bewegung das Thema. In den Straßen konnte man nicht verhindern, eine der Vertriebsstellen der Ludendorff Literatur zu passieren. Die Pamphlete lagen zahlreich aus. Der „Völkische Beoabachter“ und „Der Stürmer“ fanden reißenden Absatz. Buchhandlungen hatten ihre „völkischen“ Schaufenster. Hitlers „Mein Kampf“ und Haushofers Geopolitik lagen dort, Grimms Roman, dessen Titel das Schlagwort der Nationalsozialisten werden sollte, „Volk ohne Raum“, Rosenbergs Mythos des zwanzigsten Jahrhunderts und so weiter und so fort. Begriffe wie „Lebensraum“, „Deutschland erwache“, „Volk ohne Raum“, „der Jude“, „die jüdische Asphaltpresse, die den inneren Verfall anstrebt“ (Zeitungen wie die Frankfurter oder Vossische, die als „jüdisch verseucht“ angesehen wurden) flossen nun in die unkritisch bejahenden Schülergespräche und, sehr bald, als Quellenmaterial in die Referate.
Die kommenden Jahre sollen zeigen, wie rasant schnell sich aus dem Gerücht über die Juden, wie Adorno den Antisemitismus nennt, ein Bild formt, das sich im Einzelnen zu einem Wissen verfestigt. Trepp hat den Antisemitismus stets als irrationales Gefühl angesehen, von den Herrschenden in Kirche und Gesellschaft immer wieder für eigene Zwecke ausgenutzt. Als Gefühl getragen aber wird er von den Bürgern selbst, die bald für Adolf Hitler wählen, viele nicht trotz seiner judenfeindlichen Haltung, sondern genau deswegen. Gunda Trepp, Der letzte Rabbiner, 95 ff. © WBG
Es war und blieb das Wesen des Judentums, kritisch dafür zu sorgen, dass man nicht zu schnell, zu leichtfertig sich beruhige. Dieses Drängen und dieses hartnäckige Fragen in Politik und Kultur, in Literatur und in Leben und Gemeinschaft, das war im wesentlichen, so scheint es mir, der bedeutendste Beitrag des deutschen Judentums; nicht zu erlauben, dass man sich schnell beruhige, sondern ethische Fragen durchdenke und sie im Gewissen beantworte. Fragen zu stellen, kritische Fragen, die ans Herz der Dinge gingen. Hätte die deutsche Gesellschaft auch nur einen Funken der Erkenntnis von Jaspers gehabt, dann hätte sie dieses Wesen des Judentums erkannt.
Doch an diesem Punkt war die Gesellschaft nie. In den Jahrhunderten zuvor hatten sich Ablehnung der Juden und der Hass gegen sie aus dem Antijudaismus gespeist, doch mit dem konnten die Herrscher, wie Adorno und Horkheimer ausführen, „keine Masse mehr in Bewegung setzen“. Statt der Jesusmörder hatten viele nun die Nichtarier, die Nicht-Volksangehörgigen vor Augen, wenn es um die Juden ging. Dieses neu geschaffene Bild zerstörte jede Chance der jüdischen Staatsbürger, dass man ihre Verdienste für das Vaterland und ihre Sorgen darum anerkannte. Dass man sie überhaupt als Staatsbürger anerkannte. Denn nun war es die Rasse, die darüber entschied. Für die Juden war irrelevant, ob das Stereotyp – die in Verleugnung jeder Realität gezeichnete Karikatur von ihnen – auf „falscher Projektion“ beruht, wie Adorno und Horkheimer schreiben, oder auf Neid oder sonstige niedere Charaktereigenschaften, wie es andere Autoren annehmen. Sie sind, obgleich sie formal frei sind wie nie zuvor, für viele ihrer Mitmenschen als Bürger draußen. Das, was Leo Trepp ebenfalls in seiner Rede sagt, nämlich dass „jeder Bürger in Wirklichkeit auch ein Bürge für die Gemeinschaft, in der lebt, ist“, darf ausgerechnet auf die Juden, von denen überproportional viele sich dieser Verantwortung stellen wollen, nicht mehr zutreffen. So werden Frankfurter Zeitung und Berliner Tageblatt, die beide den
Demokratisierungs- und Friedenskurs der Regierung unterstützen, als „Judenpresse“ angegriffen, Rathenau, der sich nach Aussagen seiner Kollegen aufrieb für das Wohl Deutschlands, ist ermordet worden, und jüdische Bürger wie Leo Trepp werden nicht einmal mehr eines Dialogs für würdig gehalten, wie seine
Beschreibungen aus Schule und Universität zeigen. Die Mehrheit der deutschen Bürger wollen keine Bürgen für die Gesellschaft sein, sie wollen nicht mitarbeiten an einem Staatsgebilde, das zum ersten Mal Demokratie verspricht. Sie wollen sich nicht selbst engagieren, sondern für politische Fehler in der Vergangenheit und für alles, was in der Gegenwart nicht funktioniert, Schuldige finden. Sie wollen nicht Bürger, sie wollen Untertanen sein. Und die jüdischen Bürger werden sie in den kommenden Jahren Schritt für Schritt zu nicht vorhandenen Menschen
erklären, zu Nichtmenschen. Schon Jahre vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten, wie Leo Trepp schreibt.
Ganz schlimm wurde es, als 1929 ein neuer Schüler in die Klasse kam, Rudolf Zimmerling, sechs Jahre älter als wir. Er verseuchte beinahe die gesamte Klasse mit seinen rechten Ideen. Obwohl ich vorsichtig sein will, denn was weiß man schon über andere Menschen? Der Neue war populär, stets umringt von meinen Mitschülern, doch inwieweit die wirklich seinen Überzeugungen folgten oder einfach dort sein wollten, wo die Gruppe war, kann ich nicht sagen. Und ich muss berücksichtigen, dass sich niemand dem Einfluss der Umwelt entziehen konnte, auch ich nicht. Es dauerte eine Weile, bis ich nach meiner Auswanderung erkannte, dass der Kapitalismus, den wir in der Schule als „böse“ anzuprangern gelernt hatten, nicht so böse war, sondern im Gegenteil den Lebensstandard der Amerikaner verbessert hatte, und man allein seine Auswüchse kritisieren konnte und musste. Ich wusste also nicht, was in den anderen vorging. Die Richtung schien klar. Doch ich konnte nicht fragen. Ich war in jeder Beziehung von der Gemeinschaft ausgeschlossen. Dieses Gefühl wiederum verstärkte meine
Sensibilität, die sich noch einmal vertiefte, als bald persönliche Angriffe kamen. Öfter nun hörte ich Bemerkungen über „den dreckigen Juden“. In Französisch fragte mich der Lehrer, „was ist Kragen“, ich sagte unkorrekt „fauz cou“ statt „faux col“. Das ist richtig, sagte jemand, „er hat einen dreckigen Hals“.
Mein Mitschüler Hans Steyer hielt einen Vortrag über die Schlechtigkeit der Juden bereits zu biblischen Zeiten. Der gute Sozialdemokrat Dr. Berghäuser, der sofort nach der Machtergreifunge in den Ruhestand versetzt wurde, versuchte dagegen zu argumentieren. Ohne Erfolg. Ich sprang ihm bei, doch die Klasse grölte und ließ mich nicht einmal enden. An einem anderen Tag brachte Dr. Berghäuser eine Broschüre mit Informationen über Universitäten in die Klasse. „Möchte jemand es haben?“ Niemand außer mir wollte es. Ich bekam es. Zimmerling fragte, „Darf ich einmal für ein paar Minuten hineinsehen?“ Klar. Ich gab es ihm und fragte ihn vor der letzten Stunde, ob ich das Heftchen nun zurück haben dürfe. „Einem Jud gibt man nichts zurück“, war die Antwort. Die Klasse schwieg. Er behielt es.
Mit Ausnahme der beiden Freunde war ich vereinsamt. Nur Werner und Peter-Paul hielten weiter zu mir. Werner, der in die Parallelklasse ging, trug mir nun am Samstag die Tasche in die Schule, da unser neuer Rabbiner den Mainzer Eruv nicht anerkannte und uns das Tragen am Schabbat verbot, und mit beiden arbeitete ich nach wie vor abends oft stundenlang an den Mathematikaufgaben. Dennoch verband mich auch mit den beiden nichts Substantielles. Es war, als gäbe es eine unsichtbare Schranke zwischen den anderen und mir. Manchmal sprachen wir über Kunst oder ein Buch, das wir zufällig alle gelesen hatten, doch das waren Bruchstücke meines Lebens. Oper oder klassische Musik und natürlich jüdische Fragen konnte ich mit ihnen nicht diskutieren. Dasselbe galt für Fritz Blumenthal, der in einem weit weniger religiösen Elternhaus aufwuchs. An
Sonntagnachmittagen ging ich manchmal allein spazieren, ab und zu über die
Rheinbrücke bis nach Wiesbaden, um mir ein Kurkonzert anzuhören. In manchen Momenten fühlte ich mich so allein, dass ich meine Hand an den Häuserwänden rieb, um etwas zu berühren.
Viele Jahre nach dem zweiten Weltkrieg sagte Peter Paul Etz zu mir: „Ich habe mir Gedanken gemacht. Wir saßen neun Jahre lang zusammen auf der Schulbank, und ich wusste nie etwas über deinen Glauben oder deine Lebensauffassungen.” Er hatte nie gefragt, und während mein Vater uns ganz selbstverständlich auch über den christlichen Glauben erzählte, schienen die Christen ihren Kindern nichts über das Judentum vermittelt zu haben. Als Erwachsene holten Peter Paul und ich die Gespräche nach. Wir blieben Freunde bis zu seinem Tod. Er hatte im Krieg eine
Bestallung zum Offizier abgelehnt, weil er dann der Partei hätte beitreten müssen. Später wurde er Professor für Kunst und ein bekannter Maler. Zwei seiner Werke hängen in unserem Schlafzimmer. Auch mit Werner dauerte die Freundschaft an. Beide kamen aus streng katholischen Elternhäusern, und später als Rabbiner unter den Nazis habe ich mehr als einmal erfahren müssen, dass die von ihrem Glauben
überzeugten und ihn bewusst lebenden Christen am besten gegen den Nationalsozialismus immunisiert waren.
Als die Franzosen 1930 endlich aus dem Rheinland und somit auch aus Mainz abzogen, feierte die ganze Stadt. Zu den offiziellen Feierlichkeiten kam der Reichspräsident nach Mainz. Mein Herz hüpfte, als er aus der Stadthalle kam und ich an seiner Seite den liberalen Rabbiner Levi sah, aufrecht und würdig, mit einem Davidstern auf der Brust, die Amtskette des Armeerabbiners. Doch dann mussten wir Schüler Spalier stehen, um die Menschenansammlung zurückzuhalten, und mein Stolz auf den Vertreter der Juden verflüchtigte sich in den Hintergrund meines Bewusstseins. „Wenn er kommt, haltet euch bei den Händen, damit die Menge nicht durchbricht“, hatte es geheißen. Als das Auto mit Hindenburg und dem Oberbürgermeister langsam vorbeifuhr, versuchte ich, die Hand meines Nachbarn Hans Steyer zu nehmen, doch er sträubte sich derart, dass ich aufgab. Im September des selben Jahres errangen die Nationalsozialisten bei der Wahl überraschend 107 statt bisher vierzehn Sitze. In der Klasse brach Jubel aus. Einer der Schüler schrieb das Ergebnis groß an die Tafel. Niemand löschte es. Von diesem Tag an begannen auch einige der Lehrer, meinen Gruß auf der Straße nicht mehr zu erwidern. Dr. Hartleb, der mir meine Bemerkung zur Emser Depesche wahrscheinlich ohnehin nie verziehen hatte, drehte nun demonstrativ den Kopf zur anderen Seite, wenn er mich kommen sah.
Im Abgangszeugnis erhielt ich ein „ungenügend“ im Turnen, doch sonst spiegelten meine Noten meinen Wissensstand und waren fair. Zum Abschiedsessen und zur
Abschlussfeier ging ich nicht. Ich fühlte, dass ich mit der Klasse nichts mehr zu tun hatte. Als ich vor einigen Jahren zum ersten Mal die Abiturszeitung las, in der jeder Schüler kurz beschrieben wurde, habe ich Gott für diese Entscheidung gedankt. Über mich heißt es: „Der Trepp kimmt mir vor wie e chemisch Element. Wenn mer’s ansteckt, ich glaab, dass es dann brennt. Er ist von allerlei Pflanzgerüche umschwängert, so dass er uns die Lust an der Schul nit verlängert.“ Und an anderer Stelle: „Anfang einer französischen Stunde. Eine schneidende Stimme: ‚Trepp, commencez à lire!’ Darauf eine ölige Stimme: ‚Mon professeur, jai mal au col.’ – Scheinbar kann der mit eine dreckische Krage nit lese! D. Red.“ Das war der Trepp für die anderen: Der dreckige, stinkende Jude.
Ich war froh, als die letzten Schuljahre vorbei waren. Sie waren eine Prüfung für mich, die mir, wie ich hoffe, ein tieferes Einfühlungsvermögen und eine größere Liebe für meine Mitmenschen gegeben hat. Meine Zuneigung heute erstreckt sich auf meine alte Schule und die neue Schülergeneration, zu der ich oft gesprochen habe. Diesen Schülern kann keine Schuld für die Vergangenheit zugesprochen werden. Doch sie müssen das Geschehene verstehen und sich dadurch verpflichtet fühlen, aktiv zu einer Welt beizutragen, in der es keinen Antisemitismus und Rassismus mehr gibt. Wir sind weit davon entfernt. Die Hoffnung dürfen wir dennoch nicht verlieren. Martin Buber sagte mir einmal: „Die Zukunft unserer Welt ruht auf der Jugend, die den Willen hat, sich für das Wahre, Schöne und Gute mit voller Kraft einzusetzen.“ Dem ist nichts
hinzuzufügen. Gunda Trepp, Der letzte Rabbiner, 100 ff. © WBG
Das Denkmal steht hier in der Form einer Mauer. Mauern haben eine doppelte Funktion. Sie können trennen wie die Mauer in Berlin. Mauern können aber ebenfalls zu den Stützen eines Baus werden, der viele Menschen in sich einschließt. Die Mauern eines Gotteshauses sind solche Stützen, und zwar nicht nur für diejenigen, die der Religion angehören, denen das Gotteshaus im engeren Sinn geweiht ist, sondern für alle. Wir haben ja alle einen Vater, und ein Gott hat uns alle geschaffen, so dass daher jedes Gotteshaus mit seinen Mauern symbolisch zum Bau einer besseren, Gott gegebenen und Gott gewidmeten Gemeinschaft beiträgt. Nicht eine Antwort bietet diese Mauer, sondern eine Frage. Diese Frage, die den einzelnen dazu hinführen soll, sie immer wieder neu aus seiner eigenen Situation und Notwendigkeit und der Notwendigkeit der Gesellschaft zu beantworten, diese Frage ist in gewissem Sinne ein Vermächtnis der Juden.
Doch es gehe nicht um die Juden, sagt er, es gehe im alle Menschen. Jeder, der an dem Mahnmal vorbeilaufe, solle sich die drei Fragen stellen: Haben wir nicht alle einen Vater? Hat uns nicht ein Gott geschaffen? Warum verachten wir dann einander?
Und hier ein weiteres Beispiel für seinen Umgang mit dem Verbrechen:
Schon der Hass auf die Juden in der Kaiserzeit, „dieser gute, alte Antisemitismus“, wie ihn die Juden unter Hitler nannten, selbst dieser Hass schon hatte sich maßgeblich gespeist aus dem Bild des Juden als Fremdkörper. Als der Andere, der eigentlich nicht dazu gehört. Einer Tradition verhaftet, die unheilbar
Vergangenheit ist. Jemand, der keinen Platz in einer westlichen Gesellschaft hat. Ein Bild, das sich über Jahrzehnte gehalten hat, und bei vielen auch nach 1945 halten soll. Selbst in meinen Jahren mit Leo wählten Tageszeitungen und Magazine noch Fotos von Ultraorthodoxen, um jüdisches Leben zu illustrieren, oder den israelisch-palästinensischen Konflikt. Wussten die Redakteure nicht, dass die Ultraorthodoxen selbst in Israel eine Minderheit waren, wenn ihre Zahl auch anstieg, sehr zu Leos Leidwesen? Oder war es einfach bequem? Im ersten gemeinsamen Jahr arbeite ich vollzeit in einer Zeitungsredaktion. Juden? Ahnung hat keiner, doch gerne kommentieren die meist atheistischen Kollegen gewalttätige Situationen mit den Worten „Auge um Auge, Zahn um Zahn führt nie weit“ oder erzählen vom Rachegott des Alten Testaments. „Vielleicht wählt man diese Bilder bewusst “, sage ich also zu meinem Mann. Doch der, immer Idealist, winkt ab, „Ignoranz“, sagt er, „und gegen die kann man was tun.“
Das ist sein Weg, sich der Vergangenheit zu stellen: er will gemeinsame Zukunft schaffen. Vor Hass gegen die Deutschen wollte er sich ein Leben lang schützen. Wem helfe es denn, wenn man Hass trage von einer Generation in die andere, fragt er in einem Essay für ein amerikanisch-jüdisches Magazin, den er 1973 schreibt. „Sind wir romantisch emotional, hat Gefühl das letzte Wort, wenn wir unsere Meinungen abwägen und unsere Handlungen dirigieren? Wenn Leo Baeck Recht hat, und das Judentum anti-romantisch ist, dann widerspricht ein romantischer Emotionalismus unserer Pflicht als Juden“, schreibt er in Antwort an die amerikanische Autorin Cynthia Ozick, die sich geweigert hat, ein paar Worte für den Klappentext von „A Beautiful Day“ zu schreiben, die englische Version von Dieter Wellershoffs Buch „Ein schöner Tag“, worum der Verlag sie gebeten hatte. Sie hatte ihre Ablehnung mit der Ermordung der europäischen Juden begründet, die für sie stets präsent sei. „Ich schreibe mit zwei Mündern, einer gehört dem Toten, und keiner der Münder ist bereit, etwas über Dieter Wellershoff zu sagen, der die Ostfront überlebte, um einer Jüdin in New York seine Arbeit zu schicken.“ Leo Trepp fragt, „Können wir, unter dem Wort Gottes stehend, alle Deutschen und ihre Kinder und Kindeskinder ablehnen? Können wir so etwas tun, ohne uns selbst in Hass zu vernichten? Ist unsere Beziehung zu den Deutschen eine Art Hiob-Prüfung für sie und für uns? Ich weiß keine Antwort.“ Doch für sich hat er entschieden. Er kann und will nicht hassen. „Hass zerstört gänzlich, Liebe heilt gänzlich“, schreibt er und wählt die Liebe. Gunda Trepp, Der letzte Rabbiner, 200 ff., 230 ff. © WBG
Etwas scheint sich zu drehen in der Gesellschaft. Und für ihn hat das zu tun mit der unverarbeiteten Geschichte. In der Politik, sagt er an diesem Tag im Landtag, sprächen viele von einem „neuen deutschen Selbstbewusstsein“. „Das schafft man aber nicht, in dem man das Geschehene unter den Teppich kehrt, dabei entstehen nur Neurosen.“ Tage wie der 27. Januar, der Auschwitzgedenktag, könnten tatsächlich genutzt werden, um „ein wachsendes deutsches Selbstbewusstsein“ zu gestalten, dann, „wenn sich schuldlose, aber mutige
Menschen der Vergangenheit stellen, um eine immer bessere Zukunft zu bauen.“
Menschen wie auch Gemeinschaften, die sich nicht über ein moralisch begründetes Ziel verständigten, was für ihn idealerweise das Streben nach „immer höherem Leben in Gerechtigkeit“ ist, lebten nicht wirklich, „sie reihen ihre Tage aneinander“.
Ich habe ihn so noch nicht sprechen hören. Obgleich ich den Text gelesen habe, scheint er mir neu und fremd. Mein Mann spricht wie immer frei, die Worte kommen aus seinem tiefsten Herzen, er mahnt, er fragt, er schüttelt uns. Und überzieht seine Zeit maßlos. „Lass es laufen, wir schieben nach hinten“, raunt der Redakteur hinter mir dem Kameramann zu. „Ich hoffe, dass wir dies als eine ernsthafte Auseinandersetzung begreifen, der wir uns stellen müssen“, sagt Ministerpräsident Kurt Beck zu Leo.
Im Frühling desselben Jahres schildert der Berliner Tagesspiegel Übergriffe auf
Juden so: „Auf dem Kurfürstendamm wird ein junger Amerikaner, an Kleidung und Schläfenlocken als Jude zu erkennen, von orientalisch aussehenden Männern geschlagen. Arabische Jugendliche misshandeln in einem U-Bahnhof einen weiteren Amerikaner – auch er trägt Schläfenlocken und orthodox-jüdische Kleidung. In einem Bus treten junge Ausländer einem 56-jährigen Mann ins Gesicht, um seinen Hals hängt eine Kette mit Davidstern. Türkische Mädchen in einem anderen Bus attackieren eine 14-Jährige – sie trägt ebenfalls Halsschmuck mit einem Davidstern. Außerdem werden mehrere jüdische Mahnmale geschändet. So geht es weiter, Monat für Monat. In Berlin, in Deutschland, in Europa.“
Offensichtlich sind sich manche Muslime, die von ihnen ebenso bedroht werden wie Juden, in diesem Punkt mit Rechtsradikalen einig. Der Virus des Antisemitismus komme heute auch aus dem Nahen Osten, sagt Leo Trepp, hingenommen von vielen, weil eine einseitige Kritik des Konflikts zwischen Israel und den Palästinensern ein Weg sei, den eigenen subtilen Antisemitismus zum Ausdruck zu bringen. Doch Judenhass ist immer nur der Anfang. „Antisemitismus ist das Barometer dafür, was einer Gesellschaft zustoßen kann, wenn sie ihre moralische Verpflichtung verliert“, mahnt er die Abgeordneten in Mainz.
Als auf der Geburtstagsfeier unseres Freundes, eines Musikprofessors, eine uns bis dahin unbekannte Ärztin an unserem Tisch offen über die Juden wettert, die erneut die Medien kontrollierten, gehen wir. Andere Vorkommnisse in den kommenden Jahren nimmt Leo anfangs eher beiläufig wahr. Bis sie sich mehren. „Ich habe nichts gegen Juden, aber ich finde es nicht gut, dass sie immer erwarten, dass wir uns schuldig fühlen“, sagt eine Nachbarin in Berlin. Andere erzählen von ihren Angehörigen und deren Leiden in den Bombennächten, sobald sie mitbekommen, das Leo jüdischer Emigrant ist, „Unsere Eltern hatten es auch nicht leicht“, wie es eine Frau bündig zusammenfasst. „Kommen sie mir bloß nicht damit“, sagt die Mitarbeiterin einer Firma, die Ausnahmegenehmigungen fürs Parken auf dem Unigelände erteilt, als ich ihr sage, mein Mann sei kein Deutscher mehr, weil er habe fliehen müssen. „Das ist lange her, und damit habe ich gar nichts zu tun“, sagt sie.
Schon früh hatte Leo Trepp gegen die Sehnsucht der Deutschen argumentiert, einen Schlussstrich zu ziehen. In ihrem eigenen Interesse. Denn nicht nur für die Juden, auch für die Deutschen, werde es schwerwiegende Folgen haben, wenn sie das Bewusstsein der Verantwortung verlören. Ein geschichtsvergessenes Volk ist schwach, sagt er, weil Geschichte auch den Maßstab für künftiges Verhalten präge. Ohne ihn aber schreibt ein Volk keine Geschichte mehr, sondern schaue irgendwann auf eine Chronik von Ereignissen zurück. Gunda Trepp, Der letzte Rabbiner, 262 ff. © WBG